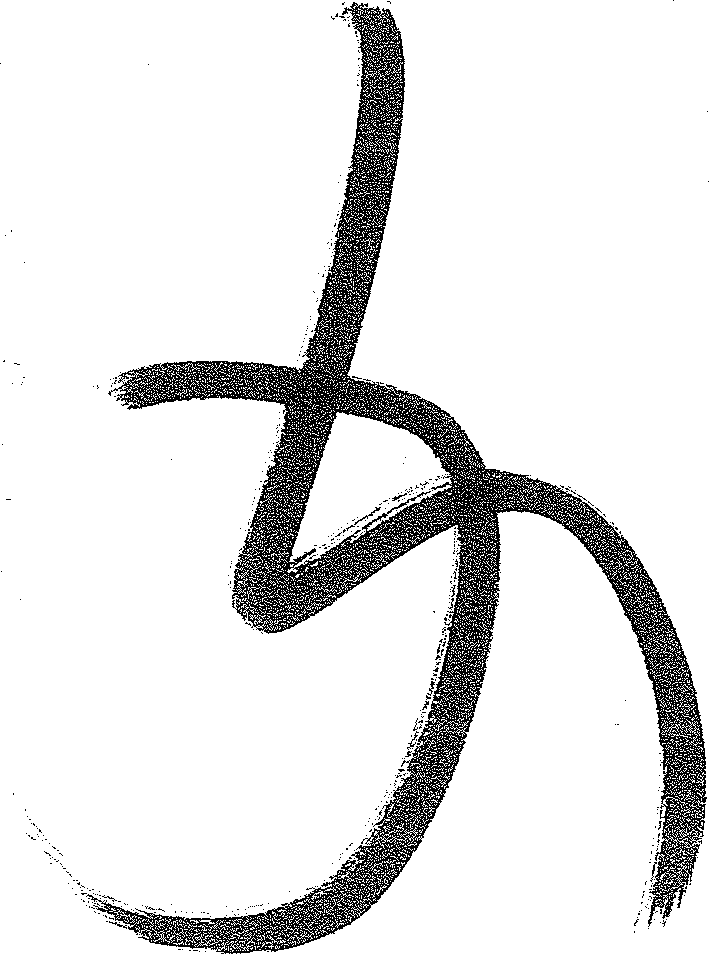Gespräch mit Anna Fortunova 2019
Das Gespräch mit der Musikwissenschaftlerin Anna Fortunova fand am 25.3.2019 in Hannover statt. -> pdf
Kunst und Wirklichkeit
AF: Sind Kunstformen, darunter auch Musik, aus deiner Sicht eine Art und Weise, die Welt zu begreifen und darüber nachzudenken, bzw. sich grundsätzlich mit ihr zu befassen?
JH: Ja, auf alle Fälle. Mein Buch Gnosis, geschrieben vor fast dreißig Jahren, beginnt mit den Worten: „begreifen, was geschieht, und begreifen, was geschehen ist“. Dieses Verstehen-wollen, wie es etwa auch Hannah Arendt thematisiert,¹ ist eine Grundhaltung, ein Wunsch, den wir als Menschen in verschiedenen Ausprägungen erleben und dessen Existenz vielleicht viel mehr Hoffnung in sich birgt als schöne Bilder über die Zukunft. Wenn wir verstehen wollen, halten wir für einen Moment an, wir lassen die Wirklichkeit zu uns kommen, wir lassen sie zu. Was geschehen ist, nennen wir Geschichte, und was geschieht, die immer auch unbegreifliche Gegenwart, berührt politische Fragen, lässt uns Stellung nehmen, lässt uns ausgesetzt sein. Und wenn wir Kunst machen, gestalten wir das, oder einen Aspekt davon. Von uns aus.
AF: Wenn über die Kunst gesprochen wird, wird oft nicht gesehen, dass es sich um eine Denkweise handelt, die uns erlaubt, die Welt besser zu verstehen. Darüber hinaus wird gleichzeitig die Welt neu erschaffen, was im Gegensatz zu vielen Wissenschaften steht, die die Welt zu erklären versuchen, ohne in einen schöpferischen Prozess treten zu müssen. In diesem Zusammenhang sprichst du auch von Politik, wobei du nicht nur feststellst, was in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten passiert. Was genau ist für dich dabei wichtig? Würdest du zustimmen, dass dadurch auch neue ‚Welten‘ (also, künstlerische Formen, die wir auch „künstlerische Gestalten“ nennen können) erschaffen werden, die wiederum zum Teil der Welt werden und diese verändern können?
Veränderung und Publikum
JH: Das kommt wohl darauf an, was du unter Veränderung verstehst. Grundsätzlich möchte ich da vorsichtig sein, und bescheiden. Erstmal ist der Wunsch, und die Arbeit: Das, was mich da sehr beschäftigt, zum Ausdruck bringen zu können. Da geht es ums Gestalten — oder mit Hegel: Vergegenständlichen —, und dadurch auch um Sinnlichkeit. Du hast ja gerade von dem Neues-Schaffen gesprochen ... — ja wir wollen einen Teil der Welt neu schaffen, und tun das einfach, im Medium der Kunst, in dem wir uns bewegen. Und dieses Neue schaffen unsere Sinne. Als Musiker also das Gehör. Das Hören als wirkliches Hören, als Emphase des Hörens. So ist der Wunsch: Das, was ich innerlich höre, was mir „vor Ohren steht“, so gut zum Ausdruck bringen zu können, wie ich es eben kann.
Und dann, darin, vor allem aber danach, gibt es den Wunsch, dass dieses Erzeugnis hörende Mitmenschen findet. Also z. B. dich, und diejenigen, die im Konzert sind, oder diejenigen, die das auf irgendeinem medialen Weg hören, auf meiner Internetseite oder sonstwo. Wenn wir also den so oft mißbrauchten und leicht missverständlichen Ausdruck „die Welt verändern“ nicht zu pauschal, nicht als Veränderung von „schlecht“ zu „gut“ verstehen, sondern als eine Veränderung, die eigentlich jeden Moment geschieht — dann würde ich das sicherlich auch für die Kunst reklamieren. Ich bin da aber in zwei Rollen. Wenn ich Kunst aufnehme, ist mir diese „Veränderung der Welt“ ganz klar, und ich kann darüber auch nachdenken. Wenn ich selbst komponiere, ist es nicht gut für mich, mich mit der Frage zu beschäftigen, welche Wirkungen das hat. Meine Aufgabe ist, was mich in einem Stück umtreibt und von mir Besitz ergriffen hat, so gut es geht „heraus“ zu bringen. Das braucht meine ganze Kraft, und es sollte möglichst in gleicher Weise geschehen, wenn ich weiß, dass ich morgen sterben werde und alles, was ich heute geschrieben habe, verbrennt, oder wenn der erfolgreichste Manager vor meiner Tür steht und nur darauf wartet, mein Stück unter die danach dürstende Menschheit zu verbreiten. Das ist jedenfalls mein Glaube.
Da beide Extreme im Moment nicht Realität sind, bewege ich mich irgendwo dazwischen. Mich interessiert sehr, wenn ich mit Menschen darüber sprechen kann, so wie wir das jetzt tun, und beispielsweise war es bei der Trauer der Fische für mich sehr wichtig, wie es für Younghi Pagh-Paan ist, weil sie die Sprecherin ist, und darüber hinaus ein für mich sehr wichtiger Mensch. In diesem Fall war ihre Reaktion wichtig; nicht unmittelbar im Komponieren, aber vor der Veröffentlichung.
AF: Und wahrscheinlich auch, weil es sich um die Geschichte Koreas handelt, die sie auch erlebt hat, also, es ist auch ihre Geschichte.
JH: Ja, genau. Wie ich Dir mal erzählte, ist es eigentlich ihr zu verdanken, dass dieser Text überhaupt zu mir kam. — Nochmal zurück: Ich wünsche mir natürlich eine Kommunikation über meine Musik, aber wir sollten offen dafür sein, dass diese Kommunikation sehr verschiedene Formen annehmen kann. Nach der Uraufführung der Fische im Sprengel-Museum war es beispielsweise eine Kommunikation für mich, die Blicke der Zuhörer*innen wahrzunehmen. Das ist auch Kommunikation und damit hat Kunst für mich viel zu tun. Also eben nicht nur diese bestimmte Art von sprachlicher Kommunikation, die wir gern verabsolutieren. Wenn ich selber Musik höre, und gerade wenn sie einen besonders starken Eindruck auf mich hat, kann ich oft gar nicht sprechen. Und das gehört eben auch dazu, und es braucht vielleicht schon wieder Kunst, um Formen dieser Kommunikation zu finden ...
AF: Ja, wenn wir bereits von diesem Schritt-für-Schritt-Prozess sprechen: jede*r Teilnehmer*in: Komponist*in, Interpret*in, Zuhörer*in – kann seinen/ihren eigenen Anteil in diesem Prozess haben, nicht wahr? Im Alltagsleben passiert zwischenmenschliche Kommunikation ebenfalls nicht nur auf verbaler Ebene.
JH: Ja, genau. Und daran erinnern wir uns sozusagen, wenn wir Kunst produzieren, und hören, und spielen, und das in einem Konzert teilen. Genau, ja.
Rationalität und Emotionalität
AF: Wenn man über Musik liest oder sich mit Menschen, die Musik komponieren, spielen oder hören, unterhält, dann wird oft zunächst das Emotionale hervorgehoben. Doch spielt in deiner – oder generell in jeder – Musik nicht nur das Emotionale, sondern auch das Intellektuelle eine Rolle? Wie würdest du diese beiden Aspekte in Beziehung setzen? Finden sich in der Musik neben Emotionen auch Gedanken (Ideen)?
JH: Ja, das sind die beiden Aspekte. Du kennst wahrscheinlich dieses Zitat von Nietzsche: „Ich weiß keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu machen“.² Es sind nicht nur Tränen, aber in jedem Fall sind es sehr tiefe Gefühle, die für mich immer mit Musik verbunden waren und sind. Nicht nur beim Komponieren, sondern auch beim Hören. Und auf der anderen Seite steht das Denken, das Reflektieren, das bewusste Handeln — ich frage mich, wie wir dieses Verhältnis zutreffend beschreiben können.
AF: Ja, ratio und emotio in der Kunst, wie auch im Leben im Allgemeinen, können wir nur theoretisch voneinander trennen. Wir fühlen – bewusst oder unterbewusst – in jedem Moment des Lebens etwas, ebenso denken wir dabei auch über etwas nach.
JH: Genau. Und als Komponist muss man natürlich auch sehr viel über bestimmte Dinge nachdenken. Sei es über das, was wir Material nennen, sei es über Form, sei es über Verfahrensweisen. Also ganz viele Ebenen, die etwas mit der Technik des Komponierens zu tun haben und die bewusst sind. Im Komponieren gibt es ein hin und her, zwischen Gefühl, oder vielleicht besser Intuition, und Bewusstheit, auch Konstruktion. Genau das ist es, was ich so beglückend finde bei dieser Tätigkeit — und auch wenn ich Musik höre —: dass die verschiedenen Anteile, Wirklichkeitsbereiche, nicht voneinander isoliert sind, sondern es immerzu hin und her geht zwischen ihnen.
Ein weiterer Aspekt sind Assoziationen. Das können musikalische Assoziationen sein, zum Teil sehr bewusste. Als ich an der Trauer der Fische gearbeitet habe, kam beispielsweise Bernd Alois Zimmermanns Tratto als eine solche Assoziation ins Spiel. Und ebenso mein eigenes Stück Stimmen, vor mehr als zehn Jahren geschrieben. Solche Assoziationen können also etwas von Erinnerung haben, oder sie können einen Raum für Anspielungen eröffnen, können Kontaktpunkte markieren. Das ist es, was Kunst für mich ausmacht: dass die Bereiche nicht abgeschlossen sind gegeneinander, sondern es immer Bewegung gibt zwischen ihnen; Wechsel und Austausch. Dann ist das Gefühl nicht nur Gefühl, sondern hat auch Bilder bei sich, und vielleicht auch Konstruktionen oder andere bewusste Anteile. Und umgekehrt ist das Denken nicht so kontrollierend, beschränkend und die Gefühle wegdrückend, wie wir das oft kennen. Sondern es geht immer vom einen ins andere. Wie Lévi-Strauss in Das wilde Denken verschiedene Arten, sich mit der Welt zu befassen, beschreibt, erleben wir Kunst auch als eine bestimmte Art der Begegnung mit Welt. Wenn es im Schreiben gut funktioniert, im Komponieren, dann ist das wie ein ständiger Fluss und ein fortlaufendes Hin- und Hergehen zwischen Aspekten von Wirklichkeit.
Interpretation
AF: Was ist für Dich bei der Musikinterpretation wichtig? Ich kann mir vorstellen, dass jeder Komponist sich freut, wenn seine Musik gespielt wird, ebenso wie über die positiven Reaktionen des Publikums. Gibt es für Dich bestimmte Kriterien, die eine Interpretation gelungener erscheinen lassen als Andere oder spielt das für dich keine Rolle? Bist du immer glücklich, wenn deine Musik gespielt wird?
JH: Grundsätzlich ja, aber natürlich leide ich, wenn ein Stück so gespielt wird, dass es eine Entstellung für mich ist. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nicht das Ideal einer Interpretation, an das man mehr oder weniger nah herankommt oder weiter weg bleibt. Die Basis ist klar: Wir wollen, dass der Notentext genau gelesen wird. Aber wenn diese Basis da ist, ist es für mich am spannendsten, wenn ich etwas durch die Interpretation über das Stück lerne, was ich vorher noch nicht wusste. Wenn der Körper und der Geist eines anderen Menschen ein Stück zu seinem Stück macht, seine Erfahrungen und seine Persönlichkeit nicht draußen lässt.
AF: Und wäre das auch ähnlich für Zuhörer*innen?
JH: Klar, natürlich.
AF: Wie du weißt, stütze ich mich in meiner Arbeit auf das so genannte „Stanislawski-System“.³ Es enthält Grundlagen der Arbeit mit der Kunst, die nicht nur für das Theater, sondern auch für Musik und alle anderen Kunstformen gelten. Wenn beispielsweise ein Schauspieler seine Rolle oder ein Musiker eine Komposition spielt und dabei irgendetwas Zufälliges fühlt, kann das nicht als eine professionelle künstlerische Arbeit angesehen werden. Es soll auch beachtet werden, dass der Dramaturg bzw. Komponist bestimmte Ideen im Sinn hatte.
Wenn jemand sich mit einer Komposition, nachdem er sie zum ersten mal möglichst aufmerksam gehört hat, beispielsweise in seinen Gedanken, beschäftigt oder wenn er sie mehrfach anhört und/oder Kommentare des Komponisten liest, kann eine schöpferische Interpretation entstehen. Das Gegenteil bestünde darin, einfach nur die Musik zu hören ohne sich dabei zu konzentrieren und sie verstehen zu wollen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, die niemandem verboten werden sollte. Wenn wir allerdings von professionellen Musiker*innen und Zuhörer*innen sprechen, würde ich, ausgehend vom „Stanislawski-System“ als zielführend sehen, dass man die Musik mit dem Wunsch hört, die Ideen des Komponisten zu verstehen und über das Stück nachzudenken. Damit geht der schöpferische Prozess, der Musiker*innen und Zuhörer*innen verändern kann, weiter. Würdest du zustimmen oder siehst du das anders?
Rezeption
JH: Ich finde, die Veränderung entsteht gar nicht durch das Nachdenken, sondern einfach durch diesen Prozess, den du schilderst. Denn, wenn ich nochmal auf die Politik komme, als Verfasstheit von Gesellschaft, wie sie sich jeden Tag äußert: Wo haben wir diese Möglichkeit? Wir sind eingebunden in Systeme, und sollen vor allem funktionieren. Und dagegen steht dieser Prozess von Vertiefung, bei dem und durch den wir uns entfalten und das Unberechenbare entsteht.
Dasselbe geschieht, wenn ich einen literarischen Text lese. Denn wenn das wirkliches Lesen ist, ist es auch ein ständiges Hin und Her, und genau dadurch ein Verweilen bei der Sache. Am deutlichsten vielleicht bei einem Gedicht. Welchen Sinn macht es, ein Gedicht runterzulesen, es bestenfalls grammatisch zu verstehen, und dann umzublättern, das nächste zu lesen, und so weiter? Keinen. Sondern wenn uns irgend etwas fasziniert, dann verweilen wir dabei, und dadurch beginnt ein Prozess. So habe ich es auch in meinem Kunstgeschichtsstudium bei Martin Gosebruch erlebt. Man schaut eine halbe Stunde gemeinsam auf so eine Dia-Projektion, oder natürlich gerne auf ein Original, und dabei beginnt es, man entdeckt Dinge, es entstehen Bewegungen, und am Ende der halben Stunde ist es wirklich ein anderes Bild geworden. Und genauso bei einem Text, bei einem Gedicht besonders, einer so knappen Form, bei der die Dinge miteinander unmittelbar in Korrespondenz treten. All dies wendet demjenigen, der liest, eine offene Seite zu. Ingeborg Bachmann spricht vom „Du“ des Lesers, um das es zu tun ist. Das ist zentral in jeder Kunst, meiner Meinung und Erfahrung nach. Insofern glaube ich, die Veränderung findet gar nicht statt, indem man hinterher ein gedankliches Resultat aus einer Kunstrezeption zieht, sondern die Veränderung geschieht schon in diesem Moment.
AF: Ja, wenn man sozusagen mitmacht, oder, um mit Stanislawski zu sprechen, „erlebt“. Der erste Band „Der Arbeit des Schauspielers an sich selbst“ heißt „Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst im schöpferischen Prozess des Erlebens“. Das gilt aber auch für Musiker*innen oder Zuhörer*innen.
JH: Genau. Wenn man nicht mitmacht, dann blättert man einfach die nächste Seite um, oder hat eine vorgefertigte Technik, die man auf ein Kunstwerk anwendet. Und dann passiert eben nichts, aber es geht doch um dieses Passieren, um dieses Entstehen: Was kommt in Bewegung? Offen ist eine Interpretation, weil diese Bewegung, dieser Zugriff von verschiedenen Menschen verschieden ist und sein muss. Und wenn das Stück weiter lebt, so wie bei uns jetzt klassische Musik zum Beispiel, sind die Situationen über die Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg auch immer verschieden, durch die Veränderung der Lebensumstände. Wenn ich heute Beethoven interpretiere, habe ich natürlich einen ganz anderen Hintergrund, etwa durch die Präsenz von Medien und durch den Kanon von Klassik heute, als vor zweihundert Jahren.
Aktuelles und Zeitloses
AF: Ja, das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt. Auf der einen Seite stehen Künstler*innen, die in ihrer Kunst ihre persönlichen Emotionen und Gedanken ausdrücken wollen und auf der anderen Seite die Interpret*innen. Unser Gespräch verändert uns vielleicht auch, aber, solange es intendiert ist, dass das zwischen uns bleibt, würde ich es auch in dieser Hinsicht nicht mit einem Kunstwerk vergleichen, etwa mit einer Komposition, die von mehreren Menschen gespielt und gehört werden soll. Damit viele verschiedene Menschen durch die Stücke erreicht werden, muss der Komponist etwas hineinlegen, was ihn selbst bewegt. Es müssen aber auch solche zeitlose Aspekte sein, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten von Bedeutung sein könnten: gesellschaftliche Kontexte oder z.B. Themen wie Leben und Tod, Liebe oder Freiheit.
Einige deiner Stücke hast du in den 1990ern komponiert, aber ich bin mir sicher, dass die Beschäftigung mit vielen der Themen auch nach mehreren Jahrzehnten relevant sein wird. Eines davon ist z. B. Freiheit – oder ihre grobe Verletzung, wie z.B. politische Gewalt. Mich interessiert hierbei die Beziehung zwischen dem Persönlichen, dem Kulturellen (wie z.B. die Muttersprache, die Bildung, unser Informationsumfeld) und dem Allgemeinmenschlichen. Wie siehst du dieses komplexe Feld vom Persönlichen, Kulturellen, Allgemeinmenschlichen einerseits und vom Aktuellen und Zeitlosen andererseits?
JH: Ich kann jetzt nicht auf alle Aspekte, die du angesprochen hast, eingehen, aber ich möchte etwas zu der Wahl eines Themas und dessen Wichtigkeit sagen. Für mich ist es so, dass die Entscheidung für ein Stück und die Wahl des Themas eine große Bedeutung hat. Diese Entscheidung betrifft vieles im Leben für eine gewisse Periode, ein halbes Jahr beispielsweise.
AF: Ist das eine bewusste Entscheidung?
JH: Ja, es ist bewusst, aber es ist natürlich auch mit — da sind wir wieder beim vorherigen Thema — Gefühlen oder Intuitionen verbunden. Es läuft ja nicht so, dass der Kopf sagt: „Jetzt machen wir mal das“. Das habe ich wieder so deutlich bei meinem letzten Stück, der Trauer der Fische, erlebt. Ich hatte eigentlich etwas anderes vor, auch durch den Auftrag für das Stück, und bin dann schließlich über viele Umwege zu dem gekommen, was tatsächlich zum Thema werden konnte. Ein Thema, bei dem ich wirklich „ich“ sein kann; ein Thema, das mir selbst wesentlich und wichtig erscheint. Nur so kann ich Musik schreiben. Also insofern ist diese Entscheidung für ein Thema sehr zentral. Und das Thema ist oft nicht einfach da, sondern es bildet sich heraus, ist selbst schon Ergebnis eines Prozesses.
Kontrollieren und Freilassen
JH: Mir fällt durch unser Gespräch etwas auf, was mit der Frage nach der Wichtigkeit eines Themas zu tun hat. Es gibt Dinge im Komponieren, wie die Beispiele, die ich eben genannt habe, die „unbedingt“ sein müssen, oder gesucht werden, bis sie hoffentlich gefunden sind. Da gibt es keine Kompromisse, sondern es geht um „Leben oder Tod“, um Anton Bruckner oder Younghi Pagh-Paan zu zitieren. Und dann gibt es andere Dinge, die im Prozess des Arbeitens — zumindest bei mir — nicht wichtig sind. Beispielsweise die Frage nach dem Erfolg oder einer zählbaren Wirkung, oder die Frage, was von diesem Stück in der Zukunft bleiben wird. Ich finde es sehr wichtig zu wissen, was hier mein Bereich an Arbeit und an Entscheidung und an Leidenschaft ist, und was auch nicht. Und letzteres abzugeben und nicht weiter kontrollieren zu wollen …
AF: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke dabei beispielsweise an die Interviews mit dem Dirigenten Frank Strobel, welche ich mit ihm im Februar und März 2019 führen durfte und in denen er seine Sicht als Interpret dargelegt hat. Ich sagte damals, dass auch ein lebender Komponist in dem Moment, in dem das Stück gespielt wird, nichts mehr machen kann, woraufhin Frank Strobel antwortete, dass der Komponist höchstens nach dem Konzert kommen und seine (auch kritische) Sichtweise auf die Interpretation schildern kann, doch das Konzert ist ja zu dem Zeitpunkt bereits zu Ende. In dem Moment, in dem das Stück in die Welt geschickt wird, ist ihre Darbietung nicht mehr die Verantwortung des Komponisten.
JH: Genau, sondern die des Interpreten oder der Interpretin — man kann sich dann darüber freuen oder man kann sich beklagen, wenn die Interpretation daneben war.
AF: Das ist mir auch wichtig, ich denke, man kann Gründe finden, warum Kunst von Zeit und Ort unabhängig Bedeutung haben kann. Manche Themen der Menschheitsgeschichte beschäftigen uns immer wieder, unabhängig von Kultur und Zeit. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass Komponisten, die wir aus der Musikgeschichte kennen, die Absicht hatten, unbedingt über ein Thema zu schreiben, das in 150 Jahren noch relevant wird. Doch wenn wir als Musiker*innen, Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Musikliebhaber*innen nicht tiefer in die Thematik der Stücke einsteigen, dann können wir keinen Unterschied zwischen einem Kunstwerk und etwas, was als solches uns angeboten wird, sehen und die Stücke auch nicht verstehen. Aber es ist nicht die erste Aufgabe der Komponisten, darüber aufzuklären, oder?
JH: Für mich zumindest ist das nicht so. Für andere ist es anders — da gehört dann der Diskurs über das Stück unter Umständen zu dem Stück selbst. Die Komponist*innen sind da sehr verschieden, wie ja auch ihre Musik sehr verschieden ist.
Themen und Gehalte
JH: Ich denke immer noch an die Frage der Themen. Vielleicht noch zwei Punkte dazu. Der erste betrifft die Herausbildung des Themas. Oft entsteht das Thema im eigentlichen Sinn erst beim Arbeiten und ist insofern Teil der Arbeit. Bei dem Streichquartett Wege beispielsweise wusste ich, dass es um eine bestimmte Art von Dialog mit Mozart geht. Aber was das genau heißt und welche anderen Bezüge darüber hinaus wichtig würden, das wusste ich am Anfang nicht. Das ist aber alles Thema. Und das zweite ist das Wort Thema selbst, das so viele Dimensionen hat. Als Musiker sprechen wir ja von einem musikalischen Thema, wo es dann in der Tradition beispielsweise ein „Thema mit Variationen“ gibt. Und so auch wenn wir vom Thema eines Aufsatzes sprechen, oder einer wissenschaftlichen Veröffentlichung.
Aber es gibt auch Themen in einem weniger leicht benennbaren Sinn. Bei dem Andante con moto aus dem Es-dur Quartett hat mich die Radikalität fasziniert, mit der Mozart an Grenzen geht, und das in einem gänzlich beiläufigen, unpathetischen Gestus. Wenn man das Stück liest und dabei hörend mitvollzieht, merkt man viele Stellen, die sehr merkwürdig sind: die quer stehen, die witzig sind, oder frech, aber auch abgründig und ausweglos — gleichsam aporetisch im Sinne Platons. Das Stück könnte an vielen Stellen brechen, stehen bleiben, einfach aufhören ... man müsste das mal so spielen — ein paar kleine Verdeutlichungen, und man würde diese dislozierende Kraft deutlich merken, und es wäre ganz logisch und stimmig, wenn die Musiker dann mitten drin die Instrumente weglegten und aufhörten. Das ist so radikal, ein weiteres Beispiel für das, was Schönberg in seinem Brahms-Aufsatz⁴ über Mozart sagt: Er ist, sagt Schönberg über Mozart, eigentlich viel radikaler als Beethoven, aber man merkt es nicht. Es hat mit der anderen, unpathetischen Geste zu tun, und auch damit, dass Mozart so unfassbar musikalisch ist — auch der Bruch ist Musik, es gibt kein Außen, das etwas auf die Musik legt, also merkt man bestimmte Dinge viel weniger als bei Beethoven.
Du merkst, ich verliere alle Fassung und komme ins Schwärmen — aber das meine ich als Beispiel für die vielen Dimensionen dessen, was wir Thema nennen können. Hier: Wie kann die Abgründigkeit und Radikalität dieser Musik Mozarts, wie ich sie versucht habe zu skizzieren, zum Thema werden? Diese Abgründigkeit ist eine andere Art von Thema als ein politisches, klar zu benennendes Ereignis, wie beispielsweise das Massaker auf Jeju 1948 in der Trauer der Fische.
Insofern denke ich, es ist sehr wichtig, über „Themen“ des Komponierens zu sprechen, aber wir sollten uns bewusst sein, dass das kein einfacher Begriff ist. Das kann sehr komplex sein. Das Thema entwickelt sich in der Komposition, und es gibt oft nicht nur ein monolithisches Thema, sondern es gibt verschiedene Aspekte, oder einen Kranz von Themen. Mindestens Assoziationen. Und das führt mich wieder zur Rezeption als spiegelbildlicher Prozess. Auch dort kommen ja, wenn jemand von dem Stück überhaupt angesprochen wird, viele Assoziationen auf, verschiedene, sich vielleicht ergänzende, oder auch widersprechende, oder überkreuzende. Wenn man das zulassen kann, erlebt man, glaube ich, etwas von der Komplexität oder Mehrdimensionalität von Themen.
Vielleicht hast du diesen einen Text gelesen, den ich mal geschrieben habe, vor ungefähr zehn Jahren: Wie kann man über Musik reden? Ich habe da versucht, einige der verschiedenen möglichen Arten des Reagierens zu benennen. Das merke ich in verschiedenen Zusammenhängen, seien es Seminare an der Musikhochschule mit jungen Komponist*innen, oder Gruppen von Laien in anderen Zusammenhängen. Wenn die Freiheit des Assoziierens ermöglicht wird, gerade bei Laien, ist es so aufregend, was passieren kann. Wenn jemand z.B. sagt: „Ach ja, da fiel mir jetzt eine Wüste ein“ oder: „Jetzt habe ich in meinem Magen irgendwie so ein mulmiges Gefühl“ oder: „In der Mitte des Stücks ungefähr fühlte ich mich plötzlich ganz allein“ oder: „Und dann gab es eine Stelle wo ich mit einem Mal total glücklich war“. Also so viele Ebenen: Bilder, Körperlichkeit, Befindlichkeit, Ideen. Vielleicht sagt jemand auch: „Ach ja, da mitten im Stück da bin ich total abgeschweift und dann später kam ich wieder“. Und vielleicht bildet das genau die Form des Stücks ab! Das alles gehört für mich zu der Tatsache, dass dieser Begriff des Themas oft nicht einfach umreißbar ist, sondern sich selbst in Bewegung befindet.
AF: Ich spreche in solchen Fällen, vom „Stanislawski-System“ ausgehend, von einer künstlerischen Gestalt, also, von einer künstlerischen Idee. Das kann eine künstlerische Auseinandersetzung mit einer Ahnung, einer Emotion, einem Gedanken oder aber auch mit einem Menschen, Ort, Tier, einem anderen Kunstwerk etc. sein, auch in der so genannten absoluten Musik. Beispielsweise Wolfgang Amadeus Mozart oder Sergey Prokofjew hatten als Komponisten ein ganz ausgeprägtes theatralisches Denken, welches sich auch in ihren rein instrumentalen Werken manifestiert hat. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten dafür, was eine künstlerische Idee oder künstlerische Gestalt sein kann. Also Gehalt ist da, Ideen sind da, ob es dem Künstler selbst bewusst ist oder nicht (ganz). Es kann in der Kunst nicht über Nichts gehen, es sei denn, dass ein „Nichts“ eine künstlerische Idee wäre, aber in dem Fall wäre es ja wieder als Gehalt da.
JH: Nein, es kann nicht über Nichts gehen, und es ist ja nicht nur Empfinden, sondern es ist auch Entdecken. Ich habe diesen Mozart-Satz erstmal gelesen, und dann habe ich ihn abgeschrieben; und weil man beim Abschreiben ja so langsam ist und die Musik — das berührt wiederum das Thema des Verweilens und der Zeit — dadurch noch intensiver erlebt, konnte ich vieles quasi in Zeitlupe entdecken. Es geht also nicht um eine rein subjektive Empfindung, sondern es geht durchaus um die musikalische Materie. Sicherlich kann die auf verschiedene Art erlebt werden, aber das Erleben geht auf das Material zurück.
Oberflächen und Tiefen
AF: Du schreibst in deinen Texten, dass du es magst, wenn man unter die Oberfläche geht, etwa bei der Rezeption. Ich musste dabei an ein Zitat aus dem Vorwort aus The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde denken: „All art is at once surface and symbol“/„Alle Kunst ist zugleich Surface and Symbol“.⁵ Meintest du etwas ähnliches mit der „Oberfläche“? Dein Stück Trauer der Fische beispielsweise kann man auf unterschiedliche Weisen lesen. Warum findest du das so faszinierend und warum lohnt es sich deiner Meinung nach, sich damit auseinanderzusetzen? In der Trauer der Fische zitierst du bereits vorhandene Texte. Allein in ihnen kann man verschiedene zeitliche Ebenen und kulturelle Zusammenhänge erkennen. Was wäre hier die Oberfläche und was die Tiefe? Was heißt es für dich, unter die Oberfläche zu gehen?
JH: Das ist erstmal ein ganz alltäglicher Ausdruck; wie man beispielsweise im negativen Sinne etwas als oberflächlich, also flach, nur die Oberfläche berührend, bezeichnet. Das, was wir vorhin als Verweilen, als Zeit-Nehmen bei der Rezeption von Kunst besprochen haben, gehört ebenso dazu, wie meine Erinnerung an die Bildbetrachtung, bei der die Bilder nach einer gewissen Dauer beginnen "Tiefe" zu bekommen. Dort hinzukommen, das ist ein ähnlich dringender Wunsch, wie der, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, als es um das Begreifen von Welt ging. Und vielleicht sind beide Wünsche ja miteinander verbunden.
Das Negativ dazu ist, dass wir in einer Welt leben, die sehr viele Oberflächen verkauft und produziert, die für mich sehr unbefriedigend sind, wenn ich dabei verbleibe. Es gibt keinen Lebensraum dort, und es entsteht eine negative Art von Leere.
AF: Liegt hier nicht eine der Besonderheiten und Stärken der Kunst? Du hast auch als ein Beispiel Lyrik erwähnt, bei der wir Möglichkeiten haben, in die Tiefen zu gehen. Mit mancher Lyrik, ebenso wie mit allen anderen Kunstwerken, kann man sich das ganze Leben beschäftigen und wird nicht fertig. Da kommt mir noch ein Moment in den Sinn: in dem Text Ein Problem⁶ hebst du hervor, dass es einen Unterschied zwischen der Alltagssprache und der Sprache als einem künstlerischen Mittel gibt. Jetzt bist du auf den Unterschied zwischen Kunst und Alltagsleben eingegangen. Da kann man wieder politisch werden, wenn man die Frage stellt, warum die Situation so ist und ob es gewollt wird, dass die meisten Menschen keine Zeit haben, in sich diese schöpferische (kreative) Seite zu entfalten, die jedem/jeder von uns eigen ist. Das gilt natürlich auch für Zuhörer*innen oder Zuschauer*innen. Man kann sich auch auf andere Art und Weise schöpferisch entfalten (beispielsweise im Beruf, in der Familie, in der Natur), aber meiner Meinung nach ist es ein Kriterium, ob man etwas schafft oder nur konsumiert und zerstört.
Wir müssen einerseits konsumieren, wir können etwa ohne Kleidung nicht leben, andererseits ist die kreative Seite in jedem Menschen angelegt und kann entfaltet werden. Dazu gibt es aber leider an den Schulen und Universitäten, sofern sie nicht auf Kunst spezialisiert sind, nicht unbedingt viele Chancen. Wir müssen an dieser Stelle nicht weiter über Politik sprechen, ich möchte bloß darauf hinaus, dass Kunst gerade diesen Raum schaffen kann und uns diese Gelegenheiten gibt. Jedem von uns, auch Menschen, die sonst vielleicht keinen Zugang zur Kunst haben – als Zuhörer*in/-schauer*in.
So gesehen würde das bedeuten, dass die Kunst eine ganz wichtige Rolle darin spielt, dass die Menschheit existiert. Der Grund dafür ist, dass Künstler*innen sich mit Fragen beschäftigen und auch Antworten geben, die uns erlauben, Menschen zu bleiben. Damit meine ich u. a. die Fragen nach dem Wesen des Menschlichen, nach dem Sinn des Lebens, nach der Rolle eines Menschen in der Gesellschaft etc. Einerseits sind es solche Fragen, die uns von Maschinen oder auch von Tieren (nach heutigem Stand der Forschung) unterscheiden. Natürlich können Maschinen in bestimmten Momenten schneller arbeiten, darüber sprachen wir bereits, aber dass Kunstwerke – wenn man den Begriff verwenden möchte, man kann auch Artefakte sagen – uns Möglichkeiten geben, sich schöpferisch zu entfalten, in die Tiefe zu gehen. Andere Bestandteile des Lebens bieten uns das nicht (unbedingt).
JH: Ja, und in Tiefen unserer eigenen Person zu gehen, gerade wenn wir Musik hören. Kunst ist ja kein abgeschlossener Bezirk, sondern hat ganz viele Verbindungen zu Erfahrungen, die man nicht zur Kunst zählt. Es ist ganz ähnlich, als wenn wir einen vertrauten Kontakt zu jemandem haben, den wir mögen. Wenn wir ihm oder ihr begegnen, und es eine bestimmte Art von Austausch gibt, merken wir oft, dass darüber eine Seite von uns selber angeregt wird, und vielleicht überhaupt erstmal eine Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Das ist, meine ich, ganz ähnlich wie das, worüber wir gerade in der Kunst reden, was diese Entdeckung der eigenen Seiten, Dimensionen, Potenziale, schöpferischen Kräfte und Wünsche angeht.
Geistiges und Tierisches
Vielleicht können wir sagen, dass die Kunst uns da an etwas erinnert. Für mich selbst, vor allem als Zuhörer und noch mehr als Leser, kann ich sagen, dass ich in einer bestimmten Weise nicht hätte existieren können ohne Kunst. Lange vor der Zeit, bevor ich selber komponiert habe, habe ich immer sehr viel Musik gehört, vor allem klassische Musik, in meinem Fall. Das hat eine Schicht in mir getroffen und durch diese Ansprache lebendig gehalten. Und insofern war das auch eine Rettung. Solch eine Erfahrung haben, glaube ich, viele gemacht, mit verschiedensten Musiken, Künsten, Literaturen. Eine existenzielle Erfahrung. Sicherlich verschieden für die einzelnen, aber es verbindet uns dann. Weil wir wissen, dass es etwas gibt, das sich zeigen möchte, und durch das wir in einer tieferen Weise leben.
AF: Ja, wie beispielsweise Helmut Lachenmann sagt, Menschen sind „geistige Kreaturen“.
JH: Ich hatte auch gerade auf der Zunge zu sagen, als geistige Wesen, aber ich habe es dann doch vermieden. Du hast vorhin gesagt, es unterscheidet uns von den Tieren und von Maschinen, aber ich versuche immer wieder zu einem Tier zu werden.
AF: Das ist jedenfalls der heutige Stand der Forschung. Entweder wir verstehen noch nicht, dass Tiere auch Kunst machen…
JH: Ja, Kunst vielleicht nicht, aber sie sind eigentlich da, wo ich wieder hin möchte.
AF: Ich meine, der Standpunkt von Wissenschaften heute ist, dass Tiere kein Bewusstsein haben und dass, wenn man kein Bewusstsein hat, es unmöglich ist, Kunst zu schaffen.
JH: Aber du kennst ja Kleists Marionettentheater, wo man aus dem Paradies rausgeht, und immerzu geradeaus geht, und dann — und nur dann — kommt man doch wieder zurück. Ich glaube so ähnlich ist das mit uns und den Tieren. Ich hoffe, dass ich da irgendwie nochmal halbwegs ankomme — vielleicht ja auf allen Vieren ...
AF: Ich würde jetzt gern nochmals auf einen Punkt eingehen, den du früher genannt hast: dass Kunst einen Ton in uns trifft, also, dass Kunst, auch Musik als eine Kunstform, mal trösten, mal Unterstützung und Kraft, mal einen Rat geben können. All das Wertvolle, was man vielleicht auch in manchen Situationen von nirgendwo sonst holen kann. Als Beispiel können wir an Franz von Schobers und Franz Schuberts Lied An die Musik denken, das mit folgenden Worten endet: „Du holde Kunst, ich danke Dir dafür“. Meiner Ansicht nach, soll es nicht darum gehen, dass wir es bloß als Ausdruck einer Weltanschauung der Zeiten des Romantismusʼ sehen.
Das heißt, „Hast mich in eine beßre Welt entrückt“, ist kein Klischee von Romantik, dass man der Realität entfliehen möchte. Denn so gesehen gibt es in jedem von uns und auch im Leben nicht verschiedene „Welten“? Auch eine „bessere“ Welt von Liebe, Respekt, Dankbarkeit, Glück, Kreativität, Harmonie etc.? Diese „beßre Welt“ ist also nicht esoterisch, sondern real, und wir, Menschen als „geistige“, schöpferische „Kreaturen“, sehnen uns danach. Natürlich, wenn man in ganz extremen Umständen lebt, z.B., wenn es einen Krieg gibt, dann erscheint diese Sehnsucht oft jenseits der Grenze des Vorstellbaren. Andererseits, bekanntlich haben Menschen auch in KZs Kunst geschaffen, was noch ein Beleg dessen ist, dass es lebensnotwendig ist, und dass diese „beßre Welt“ ein Teil von uns ist, in die wir ankommen wollen. Das kann bewusst oder auch unterbewusst passieren, wenn wir etwa ein Gedicht lesen, ein Musikstück hören, wenn wir mal in der Natur sind, oder wenn wir einen Menschen finden, mit dem man tiefer fühlen und denken kann, das macht uns erfüllter, glücklicher. Würdest du dem zustimmen?
JH: Ja, natürlich.
Verantwortung und Lust
AF: Ich würde gern noch auf folgendes eingehen: Du hast gesagt, die Kunst kann uns innerlich verändern.
JH: Ja, dass es sich verbindet mit Erfahrungen, die jede*r in irgendeiner Form kennt.
AF: Gleichzeitig gibt es auch eine Verantwortung der Rezipient*innen, indem man entscheidet, welche Konzerte man besucht, welche Künstler*innen man unterschützt (oder eben nicht), wie tief man Musik „erlebt“ etc. und eine Verantwortung der Künstler*innen, indem sie danach streben, Kunst auf möglichst hohen Niveau zu erschaffen. Ich beziehe mich jetzt auf den Artikel Kunst und Verantwortung von dem Philosophen Michail Bachtin, erschienen 1924 in der Tageszeitung Tag der Kunst in Nevel, Russland.⁷ Diese gegenseitige Verantwortung der Künstler*innen gegenüber der Kunstrezipient*innen und umgekehrt ist ein ganz wesentlicher Moment. Denn, wenn Menschen auf beiden Seiten diese Verantwortung nicht übernehmen möchten, wird es keine positiven Folgen für alle haben. Wenn Kunst materiell und ideell nicht unterstützt wird, kann sie in einer mittel- und langfristigen Perspektive nicht existieren. Wenn die Kunst nicht existiert, dann haben Menschen viel zu selten eine Chance, sich schöpferisch zu entfalten, in die Tiefen zu gehen, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet, Mensch zu sein usw … Selbstverständlich braucht eine der Kunst entsprechende Auseinandersetzung mit ihr zeitliche und auch andere Ressourcen.
JH: Aber wie kann man erreichen, dass das nicht zu einer moralischen Aufforderung wird? Sondern wie wir vorhin sagten: eigentlich ist es ein Wunsch, den jeder in sich hat, nämlich schöpferisch zu sein. Und dass dieses Schöpferische sich sehr verschieden äußert. Also frage ich mich: Wie kann man über dieses Thema sprechen und vielleicht auch Forderungen stellen, die aber keinesfalls zu einer moralischen Forderung werden?
AF: Ein Weg, den ich sehe, ist: man könnte einfach mehr Gelegenheiten anbieten und Beispiele geben.
JH: Ja, ich stimme dir zu. Vor allem: Einen Raum schaffen, in dem es wirklich um Hören geht. Ich habe den Eindruck, wir sind mit der Neuen Musik gerade in einer Zeit, wo ganz viel über Ideen und Ästhetik geredet wird, und ziemlich wenig über Hören. Und oft wird eine Musik gemacht, in der es gar nicht mehr ums Hören geht, sondern um Haltung oder um Statement, um Symbol oder um Coolness oder was auch immer. Da fehlt mir das, was Musik wesentlich ausmacht: Hören als Hören, als Wahrnehmung und Feinheit. Was geschehen müsste: Diesen Platz des Hörens zu ermöglichen, und dabei auch zum Hören aufzufordern. In aller Freundlichkeit zu sagen: „Du bist eingeladen, komm hier her und du kannst ganz viel erleben an diesem Ort, wenn du Deine Ohren aufmachst“.
Und diese Ohren, die sind zu, aus vielen Gründen. Es kann aber sehr schön sein, wenn sich die Ohren öffnen. Für mich haben sich die Ohren ein ganzes Leben immer weiter geöffnet, und das hört auch nicht auf. Ich entdecke immer noch so viel Neues im Hören, und das möchte ich vermitteln: Wie schön das ist, und wie politisch auch. Denn es heißt auch, Klänge eben nicht einzusetzen wie ein Objekt, über das ich verfüge, sondern Klänge als solche da sein zu lassen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sie selbst zu werden und zu sein. So wie es auch im Komponieren ist: Komponieren als Schaffen von etwas, das man sich selbst überlässt, das man weggibt. Wir verfügen, wie wir vorhin sagten, nicht über die Wirkung. Aber auch im Komponieren selbst, wenn es gut läuft, verfüge ich in einer bestimmten Weise nicht, ich bin kein Herrscher, ich walte nicht, sondern ich ziehe mich in gewisser Weise zurück und überlasse die Dinge – nachdem ich viel überlegt und gearbeitet habe – sich selber. So wie Kinder, die dann spielen.
AF: Ja, weil das, was du vorhin in Bezug auf die Trauer der Fische geschildert hast, dass dieser Prozess dann irgendwann seinen eigenen Weg findet, einen führt, oder?
JH: Ja, genau, das nimmt seinen ganz eigenen Weg, und es ist verrückt und beglückend, dass das passieren kann ...
AF: Ja, dabei kann man auch etwas für das Leben lernen. Meiner Meinung nach geht es hier um diese Kunst oder Weisheit, die Dinge, die man verändern kann, zu bewegen, und die Dinge, die man nicht verändern kann, anzunehmen.
Isolation und Verbindung
JH: Ja. Und es ist wichtig, über das Verhältnis nachzudenken zwischen dem, was wir in der Kunst erleben, und dem, was wir sonst als Wirklichkeit erfahren. Zunächst einmal scheint eine Art geschützter, abgeschlossener Raum zur Hervorbringung von Kunst zu gehören. Für mich jedenfalls ist das so. Wenn ich komponiere, nehme ich mir einen Platz dafür, in den nichts anderes kommen darf. Ich gehe nicht ans Telefon, ich lese keine E-Mails; ich bin sozusagen „nicht da“. Und nur in diesem Abgeschlossen-sein kommt es dazu, dass die Dinge sich „von selbst“ ereignen. Und so wünschen wir uns dieses Sich-Ereignen auch auf der Hörerseite. Der Hörer wünscht sich, dass sich in ihm etwas ereignet, und der Komponist wünscht sich das auch. Er möchte etwas hervorbringen, das vom Hörer in seiner Weise aufgenommen wird und dadurch zu seiner Lebendigkeit, seinem „Selbstlauf“ beiträgt.
Wie du sagst, ist das eigentlich etwas, was zum Leben gehört. Etwas, was eigentlich zum Leben gehören sollte, um nicht zu sagen: in dessen Mittelpunkt stehen sollte. Aber die Wirklichkeit ist so beschaffen, dass dieser Ort der Kunst zu einem besonderen Ort wird. Denn wir organisieren unser gesellschaftliches Zusammenleben, unser wirtschaftliches Zusammenleben leider nicht so, dass das Wachstum der Einzelnen das Ziel ist, sondern wir befinden uns in einem Getriebe von Zwängen und Macht. Künstler sind in dieser Perspektive diejenigen, die sich das Recht herausnehmen, sich vielen dieser Zwänge nicht zu fügen. Was als Kunst hervorgebracht wird, steht gegen Funktionieren und Zweckbestimmtheit. Und die das hervorbringen, sind egoistisch genug, ihrer „inneren Stimme“, oder dem „Selbstlauf“ zu folgen. Das ist, so betrachtet, kein Heroismus, sondern Egoismus. Ein Egoismus allerdings, der sich nicht gegen andere richtet, sondern geradezu zum Modell werden könnte für andere.
AF: Ja, mir kommt jetzt der aus meiner Sicht sehr sehenswerte Dokumentarfilm Alphabet aus dem Jahr 2013 ein (Regie: Erwin Wagenhofer), in welchem es sich u. a. um Bildungssysteme in verschiedenen Ländern handelt. Dabei wird die Frage gestellt, inwieweit moderne Ausbildungssysteme vieler Länder dem menschlichen kreativen Potential schaden können. Im Film wird außerdem Neurobiologe Gerald Hüther interviewt, der hervorhebt, dass unsere Gehirnhälften durch das Fühlen oder Lesen nicht größer, sondern besser miteinander vernetzt werden. Es ist also nicht produktiv, rein quantitativ immer mehr zu machen, sondern es ist sinnvoller, auf die Qualität zu achten, in die Tiefe zu gehen. Das war der erste Punkt, der mir im Zusammenhang mit deiner letzten Aussage aufgefallen ist. Möchtest du dazu etwas ergänzen?
JH: Nein, das kann ich nur sehr gut nachvollziehen, dieses Bild, dass es um die stärkeren Verbindungen geht. Das ist im Grunde auch eine andere Formulierung für die Vertiefung.
AF: Ja, und mein zweiter Punkt dazu ist der folgende: du sagtest, dass es nicht um Aufopferung geht, sondern darum, dass andere Menschen – so gut wie sie können – versuchen, diese schöpferische/kreative Seite lebendig zu erhalten. Kreativität bzw. Schöpfertum kann dabei, wie gesagt, ganz Vieles im Leben sein: der Beruf, Kindererziehung oder Gartenpflege etc. Das Sprichwort „Die Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten“ zeigt eine kreative Lösung, mit Regen umzugehen, wobei Regen und Sonne natürlich auch Symbole für schwierige bzw. angenehme Situationen sein können. So gesehen kann Kunst jedem Menschen Gelegenheiten geben, das Kreative in sich zu spüren und, wie wir bereits sagten, sich daran zu erinnern, es lebendig zu halten oder auch erwecken.
JH: Genau, oder sich anstecken zu lassen.
Pädagogik und Eigenheit
AF: Ja, das ist eine Besonderheit der Kunst, die nicht unterschätzt werden sollte. Es geht dabei nicht bloß um schöne Worte, sondern eher, dass man u. a. Kindern oder Studierenden Chancen gibt, an Konzerten oder Ausstellungen schöpferisch aktiv teilzunehmen. Von Musikstudierenden habe ich mehrfach gehört, dass es selbst im Hauptfachunterricht nicht immer Gelegenheiten gibt, das Schöpferische in sich zu entfalten. Dort geht es leider nicht selten vor allem bloß um eine möglichst perfekte Technik und Gewinne bei Wettbewerben als das wichtigste Ziel. Selbst im Musik- oder Kunststudium ist es also nicht immer möglich. Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe, diese Räume zu schaffen, und auch ein sehr großes Potential.
JH: Ja, genau, das sehe ich genauso. Und wir geben natürlich genau das weiter, was wir von den positiven Lehrerfiguren gelernt haben. Bei mir ist das ganz zentral Younghi Pagh-Paan. Ich weiss von vielen meiner ehemaligen Mitstudenten und –studentinnen, dass es für sie ähnlich ist. Und da kann man dann gar nicht anders, als das in irgendeiner Form weitergeben wollen, jeder in seiner Weise und nach seinen Gelegenheiten. Wenn Unterrichten, vor allem Kompositionsunterricht, gut funktioniert, ist es ein für beide Seiten sehr schönes Zwiegespräch über das Entstehen von Räumen, und als Lehrer freut man sich natürlich an der Entwicklung der anderen Menschen, so wie man sich an der eigenen Entwicklung freut. Die ist ja auch nie zu Ende.
AF: Ja, es ist auch ein eigenes großes Thema, aber wenn du das zusammenfassen könntest, warum Younghi Pagh-Paan so wichtig für Dich ist? Was hat sie aus Deiner Sicht so besonders gemacht, auch für andere?
JH: Na, die eigene Musik zu finden und diesen Weg zu gehen … — dass es darum ging also, und dass dieser Weg mit einer unglaublichen Geduld und Liebe von ihrer Seite aus begleitet und ermöglicht wurde. Und das ist natürlich etwas sehr Existenzielles, sowohl was das Professionelle angeht, aber auch das Menschliche. Und dadurch dann auch für jeden verschieden. Ich war ja schon 34 Jahre alt, als ich angefangen habe, doch noch Komposition zu studieren. Das ist ein ziemlich untypisches Alter und ich hatte andere Dinge, um die es für mich ging, als Samir Odeh-Tamimi oder Farzia Fallah oder Tobias Klich, die auch in Bremen studiert haben. Younghi reagierte auf jeden anders, und gleichzeitig gab es etwas Gleiches in ihrer Grundhaltung. Diese Grundhaltung war kein Postulat, sondern sie hat sie gelebt und praktiziert: Uns zu unserer eigenen Musik kommen zu lassen. Wenn man das erlebt, ist es ein großes Geschenk, und es ist eine Erfahrung, die bis heute weiter wirkt und in mancher Hinsicht, ehrlich gesagt, noch wichtiger für mich geworden ist, als sie im Studium war. Denn zwar ist Younghi nicht die einzige, die diese Haltung als Lehrerin verkörpert, aber sie bleibt doch etwas Besonderes, Ungewöhnliches. Das betrifft auch die Haltung der Institution gegenüber, das heißt, ganz einfach gesagt, dass es zuerst um den einzelnen Menschen geht und nicht um die Institution — das ist leider nicht das Normale. Younghi sieht die Menschen in einer sehr eigentümlichen Art, und so ist auch der persönliche Umgang mit ihr oft überraschend, nicht vorhersehbar. Auch heute noch, wo wir sehr gut befreundet sind. Ich mag das.
AF: Ja, das erinnert mich auch an das „Stanislawski-System“. Er hat mehrmals in seinen Schriften hervorgehoben, dass Pädagon*innen und Regisser*innen mit jedem Menschen, der auf der Bühne spielt, individuell arbeiten sollten, trotz der Tatsache, dass die Basis der menschlichen Kreativität wie gesagt von persönlichen oder kulturellen Kontexten nicht abhängig ist. In dem Sinne, schreibt er, gibt es nicht „das Stanislawski-System“, sondern Gesetze der menschlichen Kreativität, der „schöpferischen Natur“ des Menschen. Stanislawski hat als Theater- und Opernregisseur, Schauspieler und Pädagoge mehrere Jahrzehnte diese Gesetze erforscht und die Ergebnisse seiner Studien in den drei Bänden Die Arbeit des Schauspielers dargestellt. Doch trotz des Titels geht es dabei nicht nur um ein System des Schauspiels, sondern um anthropologische Gesetze der menschlichen Kreativität. Die Aufgabe des Pädagogen oder der Pädagogin ist es, diese in Schüler*innen möglichst frei sich entfalten zu lassen. Das nimmt natürlich mehr Zeit und Arbeit in Anspruch, wenn man sich mit jedem Menschen einzeln beschäftigt. Dann kann aus diesem Menschen eine Persönlichkeit werden, die künstlerisches Denken beherrscht. Man hat Glück, wenn man solche Lehrer*innen hat.
Menschen und Institutionen
JH: Ja, das ist ein Glück, und es ist nicht immer so. Denn diese Haltung reibt sich an vielen institutionellen Vorgaben. Sie steht vollkommen quer zum Notengeben, denn durch Benoten werden Leute miteinander und gegeneinander verglichen. Und das geht in eine ganz falsche Richtung. Und so gibt es diese Noten und einige andere Dinge, die ein festes Korsett mit sich bringen, so dass wir doch merken, dass wir in die gesellschaftlichen Systeme eingebunden sind — auch wenn wir uns mit dem Kompositionsstudium insgesamt in einem so privilegierten Garten bewegen. Das ist eigentlich das, wo es anstrengend wird, und wo sich das gemeinsame Lehr-Lern-Verhältnis an den anderen gesellschaftlichen Realitäten reibt. Das eigentlich Unterrichten ist nicht anstrengend — vorhin z.B. habe ich mich mit einer Studentin getroffen und dann sind aus einer Stunde drei geworden. Das war keine anstrengende Zeit für mich, sondern das war eine sehr erfüllte Zeit.
AF: Ja, das kenne ich auch.
JH: Wir erleben also bei solchen Erfahrungen verschiedene Anteile der Wirklichkeit. Elemente von Freiheit, von wirklicher Begegnung, von gemeinsamem Lernen, und zwangsläufig auch den Tribut an gewachsene gesellschaftliche Macht, die Stempel verteilt, die Zugänge ermöglicht oder verwehrt, die Menschen untereinander vergleicht und in Konkurrenz setzt.
AF: Man kann Kunst und andere Bereiche des Lebens oft nur theoretisch voneinander trennen. Professionelle Künstler*innen oder Kunstpädagog*innen stehen ja auch im Leben. Andererseits gibt es Menschen, die beruflich nichts mit Kunst zu tun haben und trotzdem ein Teil von künstlerischen Prozessen sind (wie etwa Musik- oder Theaterliebhaber*innen), wobei das nicht in allen gesellschaftlichen Kontexten bzw. Ländern möglich ist. Wir leben aber in einer von diesem Standpunkt aus gesehen privilegierten Gesellschaft (im Vergleich zu anderen Ländern), in der man die Frage stellen kann, was der mainstream ist und wie man Menschen mehr Gelegenheiten anbieten kann, sich schöpferisch zu entwickeln. Denn manchmal sagten mir Musikstudierende: „Es ist alles schön und gut, unter die Oberfläche zu gehen, Stücke, die ich spiele, zu verstehen, aber, um Wettbewerbe zu gewinnen, brauche ich das nicht, es ist also schon in Ordnung so wie es ist“.
Das deute ich als ein Hinweis darauf, dass auf dem ‚Musik‘- und generell ‚Kunstmarkt‘ ökonomische Gesetzte eine sehr wichtige Rolle spielen können. Das sorgt für eine Reibung mit Gesetzen der Kunst und prallt in extremsten Fällen zusammen. Die Gesetze des Business, die auf Gewinn abzielen, passen nicht mit künstlerischen Idealen zusammen. Ich bin der Meinung, Menschen sollten vor allem Möglichkeiten haben, ihr künstlerisches Potential frei entfalten zu lassen und darüber informiert sein.
JH: Ja, ich nehme es so wahr, dass heute quasi als mainstream eine Selbstvermarktung stattfindet, die in meiner Generation noch nicht so stark war. Für Leute, die 20 oder 30 Jahre jünger sind als ich, ist es schon ganz selbstverständlich, dass man das zu tun hat. Nicht alles daran ist schlecht; es führt beispielsweise dazu, dass sie gute Webseiten haben, wo man in kurzer Zeit findet, was man sucht. Aber bedenklich wird es, wenn man aus der eigenen Kunst so selbstverständlich eine Ich-AG macht. Dabei geht es dann um Gewinnmaximierung, das wichtigste ist immer gut anzukommen, der Karriereplan wird gemacht, wie die „Vision“ eines Unternehmens. Das ist dann das Treibende, und nicht die Frage nach der Vertiefung der eigenen Kunst. (Vielleicht versteht man diesen Begriff überhaupt nicht.)
Ich glaube tatsächlich, das ist eine allgemeine Tendenz. Aber wichtig für uns ist, nicht nur die allgemeine Tendenz zu sehen, sondern die ganz verschiedenen einzelnen Menschen. Und von der Perspektive des Lehrers aus, immer die Frage zu stellen, wo ich ansetzen kann. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, statt über das große Ganze zu reden, und schon gar zu klagen.
AF: Selbstverständlich… Es gibt aber auch Pädagog*innen, welche sagen: „Nicht mein Problem“.
JH: Das wäre das eine Extrem, also sich als Lehrer da rauszuhalten. Das andere Extrem wäre, sich zu streiten und eventuell dann im Streit auseinander zu gehen. Aber dazwischen gibt es viele Abstufungen und Handlungsmöglichkeiten. Wir leben durch die Feinheiten, glaube ich. Und diese Feinheiten, diese Möglichkeiten sind in den Situationen immer gegeben. Wir sollten zwar auch einen Blick auf die allgemeinen Tendenzen haben, wir sollten sie wahrnehmen und kritisch diskutieren, aber wir sollten immer auch wissen, dass wir nicht allein sind, wenn wir nicht einverstanden sind mit einem mainstream. Immer gibt es andere Leute, denen es relativ ähnlich geht wie uns selber. Und es geht eigentlich immer um diese Leute. Mit ihnen eine Community zu bilden, mit ihnen zu einem Gespräch zu kommen, mit ihnen einen Fluss und ein gegenseitiges Lernen zu eröffnen. Das brauchen wir, und wenn es gut läuft, brauchen das dann auch die anderen.
Kunst und Vermittlung
AF: Das erinnert mich wieder an den Artikel Kunst und Verantwortung von Michail Bachtin. Er beginnt seinen Text damit, dass die Teile eines Ganzen entweder „mechanisch“ oder durch „innere Einheit des Sinns“ verbunden werden können. Es geht nicht darum, dass alle Menschen gleich sein müssen oder können, sondern darum, dass eine „innere Einheit des Sinns“ zwischen Kunstschaffenden und Kunstrezipierenden durch gegenseitige Verantwortung zu erreichen ist. Wie siehst du diesbezüglich die Möglichkeiten von Journalist*innen und Musikwissenschaftler*innen? Wir haben auch von Funktionen gesprochen, die ein Komponist, ein Interpret und ein Mensch im Publikum erfüllen können. Was würdest du dir wünschen, wenn es sich um Kommentare zu Musikwerken oder Konzerteinführungen und Texte über Musik handelt? Du schreibst ja auch Texte, auch über deine eigenen Kompositionen: vielleicht sind musikwissenschaftliche Erläuterungen nicht notwendig?
JH: Doch, es ist ja eine ganz andere Ausrichtung, ob wir selbst schreiben, als Komponist*innen, oder ihr, als Musikwissenschaftler*innen, oder als Musikkritiker*innen. Ich glaube, ihr habt eine sehr wichtige Rolle. Zum einen die Vermittlung, wobei ich damit Vermittlung der Stücke meine, nicht Vermittlung der Komponist*innen als Personen. Mein Wunsch jedenfalls ist, dass meine Musik lebt und gehört wird, und ich begreife nicht, warum für viele die Person eine solche Wichtigkeit hat. Also die eine Aufgabe wäre eine Vermittlung zwischen der Musik und dem Publikum.
Und als zweite Aufgabe sehe ich einen Diskurs, der die Musik begleitet und dabei mitbestimmt, was für wichtig gehalten wird. Ich würde mich freuen, wenn es in diesem Diskurs vor allem um das Hören geht, um das konkrete Hören eines Stücks neuer Musik. Das Hören, und das Ausschreiten der Dimensionen eines Stückes. Ich finde es beispielsweise traurig, dass jemand, der so arbeitet und solche Musik geschrieben hat wie Younghi Pagh-Paan, bei aller Bekanntheit eher ein Randdasein hat im Diskurs. Stattdessen geht es um Leute, die sicher sehr klug sind und vieles mehr, die aber vor allem selbst sehr diskursiv sind. Dieser Diskurs wird dann quasi weitergesprochen von Seiten der Musikwissenschaft. Es lässt sich natürlich prima andocken. Aber leider geraten dadurch Komponist*innen aus dem Blick, die nicht in dieser Weise diskursiv sind. Das heißt, es wäre wünschenswert, Musikjournalist*innen und Wissenschaftler*innen zu haben, denen die Musik als klingende Gestalt, als klingender Körper, klingender Geist, so wichtig ist, dass sie genau das in diesen Diskurs einbringen. Dann wäre es ein wirklich musikspezifischer Diskurs, und keiner, der nur eine Verlängerung eines philosophischen, politischen, soziologischen oder ästhetischen Diskurses ist.
AF: Dazu sind analytische Instrumente notwendig, wobei eine Analyse auf verschiedenen Ebenen passieren kann. Manchmal sieht man in erster Linie etwas, was auf der Oberfläche liegt, etwa ein Zitat aus einem Volkslied. Natürlich geht es in der Kunst auch um unterschiedliche Techniken, doch sie sind kein Selbstzweck. Meiner Meinung nach ist es gewinnbringend, analytische Werkzeuge nicht nur für Form-, sondern auch für Gehaltsanalyse beherrschen zu können, wenn man Gehalt (Ideen) von einem Kunstwerk verstehen und vermitteln möchte. Ich sehe darin eine der Aufgaben von Musikwissenschaft. Es ist wunderbar, wenn auch Musiker*innen und Komponist*innen über Musik sprechen wollen, aber die Zeit ist begrenzt: wenn man eigene Stücke wissenschaftlich analysiert, geht diese Zeit nicht wiederum vom Komponieren ab?
JH: Nicht nur das. Man kann analysieren, aber es ist keine wissenschaftliche Analyse. Es ist eine Art von Analyse, die ihr Recht hat, aber es muss andere Arten geben, als Weiterentwickeln des Hörens. Jede Analyse kann eine solche Weiterentwicklung sein.
AF: Ja. Unser Ausganspunkt war, dass Kunst eine Art und Weise ist, zu denken, sich mit zentralen Fragen des Lebens zu befassen und Ergebnisse dieses Prozesses in künstlerischen Formen (in Form von künstlerischen Gestalten) zu verwirklichen. Philosophie setzt sich auch mit zentralen Aspekten des Menschseins auseinander und wir sehen dann Ergebnisse in Form von Texten. Bei philosophischen Resultaten erwartet man normalerweise nicht, dass bloß „Ja, das war nett“ als Reaktion kommt. Leider passiert es oft mit Kunst- insbesondere Musikwerken, u. a. weil wir im Gegensatz zu unseren Augen beim Lesen oder Schauen es nicht gewohnt sind, wie du sagst, unsere Ohren …
JH: ... zur Hauptsache zu machen.
AF: Man lernt es im Laufe der Zeit immer besser, wenn man will. Natürlich streiten sich die Geister heute sehr darüber, was eigentlich kein zeitgenössisches Phänomen ist: Wir können beispielsweise an die Diskussionen aus dem 19. Jahrhundert denken, so etwa an das berühmte Zitat des Musikkritikers Eduard Hanslicks: „Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen“.
Musikwissenschaft ist eine junge akademische Disziplin. Im Laufe der Geschichte haben vor allem Philosophen und Künstler sich über Kunst in Form von Texten unterschiedlicher Länge geäußert und sie tun das auch heute. Kaum ein Künstler würde ernsthaft meinen, seine Werke hätten mit ihm, mit seinen Erfahrungen, Emotionen, Gedanken gar nichts zu tun. Bereits das ist ein Hinweis darauf, dass Musikwerke ihren Inhalt (Gehalt, Sinn) haben. Abgesehen davon enthält er auch andere Elemente, über die wir am Anfang gesprochen haben: kulturelle Aspekte oder Merkmale der Zeit, zu der ein Stück geschaffen, wurde (Zeitgeist) … Meiner Auffassung nach gibt es von unserer musikwissenschaftlichen und musikvermittlerischen Seite viel zu tun, wobei es mir wichtig erscheint, auch Stimmen von Musiker*innen zu hören, damit wir (musikalische Praxis und Wissenschaft über sie) nicht in verschiedenen Welten existieren: denn Theorie kommt nie vor der Praxis, auch vor der musikalischen Praxis. Mein Eindruck ist, dass Beziehungen zwischen der musikalischen Praxis und Musikwissenschaft und -Vermittlung noch viel intensiver und schöpferischer sein können. Wie siehst du das?
JH: In jedem Gebiet geht es eigentlich um die Frage, wo das Lebendige, Schöpferische liegt, gegen das bloße, sinnentleerte Reproduzieren. Auch in der religiösen Tradition findet sich das. So erhält der Zen Buddhismus seinen Namen zwar von der Meditationspraxis (chinesisch Chan, japanisch Zen). Aber ständig ist in den kleinen verrückten Geschichten thematisiert, wie das „Erwachen“ mehr sein kann als aufgesagte wahre Worte. Und die Wachheit ist dann nicht zuletzt die überraschende, schöpferische Reaktion des Gegenübers. Wenn beispielsweise der Schüler sagt: „Meister, zeig mir bitte den Weg.“ Da fragt der Meister zurück: „Hast Du schon gefrühstückt?“ Schon das ist eine sehr „erwachte“, schöpferische Reaktion, ohne Vorlage, aus der Präsenz des Augenblicks heraus. Der Schüler ist verdutzt und sagt „ja, ja“, und hofft, dass jetzt endlich die Antwort auf seine Frage kommt. Stattdessen: „Dann wisch deine Essschale aus“. Wenn wir diese Art von Schöpferisch-sein, von Wachheit, von Er-findung in einer Situation haben können, dann sind wir wieder Kinder, die miteinander spielen, oder gar Tiere, die das noch besser können.
1 Hannah Arendt, Ich will verstehen, Selbstauskünfte zu Leben und Werk, Hg. Ursula Ludz, München:Piper 1996.
2 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, in: F.N., Kritische Studienausgabe, Hg. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 6, München:dtv 1999, S. 291.
3 Konstantin Stanislawski, Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Tagebuch eines Schülers. Teil I. Die Arbeit an sich selbst im schöpferischen Prozess des Erlebens . Übersetzt von Ingrid Tintzmann. Berlin 1999. 5. Auflage; ders., Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Tagebuch eines Schülers. Teil II. Die Arbeit an sich selbst im schöpferischen Prozess des Verkörperns. Übersetzt von Ingrid Tintzmann. Berlin 1999. 5. Auflage, ders., Die Arbeit des Schauspielers an der Rolle. Materialien für ein Buch. Übersetzt von Karl Fend, Hans -Joachim Grimm und Dieter Hoffmeier. Berlin 1993. 1. Auflage.
4 Arnold Schönberg, Brahms der Fortschrittliche, in: A.S. Stil und Gedanke, Hg. Ivan Vojtech, Frankfurt:Fischer 1992, 54-104.
5 Oscar Wilde, Preface in: The Picture of Dorian Gray. Croydon 2015. pp. 3-4/ Oscar Wilde: Das Vorwort, in, Das Bildnis des Dorian Gray. Übersetzung von Lutz-W. Wolff. München 2013. S. 5-7.
6 Joachim Heintz, laotse und schwitters, texte zu einer konstallation, online unter https://joachimheintz.de/globales/laotse_schwitters_ohne_bilder.pdf (dort S. 21-23).
7 Michail Bachtin, Kunst und Verantwortung, in: ders.: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. von Rainer Grübel. Aus dem Russischen von Rainer Grübel und Sabine Reese. Frankfurt am Main 1979. S. 93-94.